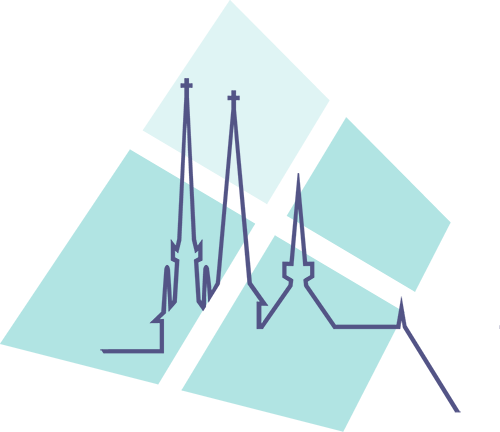Daf
Setzen Sie sich zunächst mit Ihrem Pfarrer in Verbindung um einen Tauftermin festzusetzen. Der übliche Tauftermin ist ein Sonntag. Ein sinnvoller Termin ist die Osternacht. Der Pfarrer wird Sie zu einem Taufgespräch einladen und Sie über die Bedeutung der Taufe und der damit verbundenen Pflichten für Eltern und Pate(n) unterrichten.
- wenn ich alleinerziehend bin?
- wenn ich nicht in der Kirche getraut wurde?
- wenn ich geschieden und wiederverheiratet bin?
- wenn ich nicht getauft bin?
- wenn ich selbst nicht glaube?
- Kann ein Kind getauft werden wenn ein Elternteil einer andern Religion angehört?
Ja, denn die Taufe betrifft zuerst und vor allem das Kind, das die Taufe empfängt. Es handelt sich in erster Linie um eine Beziehung zwischen Gott und dem Getauften. Bei wenigstens einem der Elternteile jedoch muss der Wille zur Taufe und zur christlichen Erziehung vorhanden sein. Eltern, die zweifeln oder nicht glauben, können ihr Kind taufen lassen unter folgenden Bedingungen: sie müssen dem Kind eine religiöse Erziehung zuteil werden lassen und dem Kind Paten auswählen, die gläubig sind und so das Kind im Glauben unterstützen können. Besteht auf christliche Erziehung keine begründete Hoffnung, so kann der Pfarrer die Taufe aufschieben, er muss die Eltern aber auf den Grund hinweisen.
Jeder Mensch, der noch nicht getauft ist, kann zu jeder Zeit zur Taufe zugelassen werden. Christen lassen ihre Kinder im Prinzip innerhalb der ersten Wochen nach der Geburt taufen. Ein Kind, das älter als 7 Jahre ist oder ein erwachsener Mensch, wird durch ein Katechumenat auf die Taufe vorbereitet.
Es empfiehlt sich, dem Kind den Namen eines Heiligen zu geben, der ihm Vorbild und Schutzpatron ist. Sollte man einen nicht christlichen Namen für das Kind auswählen, so möge man ihm jedoch einen christlichen Beinamen geben.
Mehr über Heilige und Heiligennamen finden Sie hier:
Es genügt ein Pate oder eine Patin. Der Pate/die Patin muss von den Eltern gefragt werden und zu dieser Aufgabe geeignet sein, d.h. das 16. Lebensjahr vollendet haben. Er (sie) muss selber die 3 Initiationssakramente der Kirche (Taufe, Firmung, Kommunion) empfangen haben. Er (sie) soll(en) das Kind zusammen mit den Eltern zur Taufe bringen und es bei seiner christlichen Lebensführung unterstützen.
Wer diese Bedingungen nicht erfüllt, kann als Taufzeuge fungieren.
Im Prinzip ja, wenn der zuständige Ortspfarrer die Erlaubnis hierzu gibt.
Das Kind sollte in der Pfarrei getauft werden wo es wohnt, da es durch die Taufe in die kirchliche Gemeinschaft aufgenommen wird. Die kirchliche Gemeinschaft ist für den Getauften die Gemeinschaft des Ortes wo er wohnt. Sollte aus irgendeinem Grund das Kind in einer andern Pfarrei getauft werden, so sollte der Heimatpfarrer sowie der Ortspfarrer informiert und um Erlaubnis gefragt werden.
Das Kind sollte weiß angezogen sein, muss aber nicht unbedingt ein Taufkleid tragen. Das weiße Kleid bei der Taufe geht zurück auf die Zeiten, in denen die in der Osternacht Getauften eine Woche lang (bis zum „weißen Ostersonntag“) ein weißes Kleid trugen, als Zeichen ihres Neugeborenseins in Christus. Das weiße Kleid weist uns darauf hin, uns mit Christus und dem Gewand seiner Liebe zu bekleiden, das heißt seine Lebensart zu unserer Lebensart zu machen.
Sind die Eltern verheiratet, so sollen sie das Familienbuch mitbringen, damit die Taufe eingetragen werden kann.
Die Taufkerze wird in der Regel von der Pfarrei gestiftet. Man kann jedoch auch selbst eine Taufkerze mitbringen, dies sollte man mit dem zuständigen Pfarrer absprechen.
In der Regel ja. Man sollte dies aber mit dem zuständigen Pfarrer klären.
Die Taufe kostet nichts. Sie ist ein Eintrittsgeschenk in die Kirche.
Kommioun
Sinnvoll ist das dritte Schuljahr, da im Religionsunterricht in der Schule bzw. seit der Rentrée 2017/2018 in der Pfarrkatechese (www.cate.lu) in den ersten drei Jahren Schritt für Schritt auch in das gottesdienstliche Leben der Pfarrei eingeführt wird.
Der genaue Termin der Erstkommunionfeier liegt für jede Pfarrei fest. Auskunft gibt der zuständige Pfarrer.
Nein. Jeder Christ ist frei zu entscheiden ob er an einer solchen Feier teilnimmt. Es steht des Weiteren jedem frei, dann zur Kommunion zu gehen, wenn er sich dafür entscheidet und denkt er sei reif für diesen Schritt.
Ja. Mit der Taufe wird man in die Gemeinschaft der Kirche aufgenommen. Die Erstkommunion ist dann ein weiterer Schritt in diese Gemeinschaft. Mit der Taufe wird man ein Bekannter Jesu. Mir der Erstkommunion ein Freund, den man eben auch zu einem Mahl einlädt.
Bei der Taufe versprechen die Eltern, für die religiöse Erziehung des Kindes Sorge zu tragen. Daraus ergibt sich, dass das Kind dann auch den Religionsunterricht bzw. die Pfarrkatechese besucht. Es erscheint nicht besonders logisch, wenn man einerseits aus „religiösen“ Gründen den Religionsunterricht in der Schule bzw. die Katechese nicht besucht und dann andererseits um ein Sakrament der Kirche bittet.
Eigentlich wird in der Regel nichts verlangt. In Zweifelsfällen verlangt der Pfarrer eine Taufbescheinigung. Diese erhält man in der Pfarrei, in der man getauft wurde.
Die Kinder besuchen während drei Jahren den Religionsunterricht in der Schule (1., 2. und 3. Klasse) bzw. seit der Rentrée 2017/2018 die Pfarrkatechese (Zyklus 2.1.; 2.2 und 3.1).
Außerhalb der Schule bieten die Pfarreien verschiedene Vorbereitungsmodelle in den Monaten vor der Feier an: regelmäßige Versammlungen, Elternabende, Vorbereitungstage usw. Dies wird unterschiedlich in unseren Pfarreien gehandhabt.
Die Erstkommunionfeier findet in der Regel in einer der Kirchen der Pfarrei statt, in der man wohnt.
Firmung
Nach dem allgemeinen römisch-katholischem Kirchenrecht ist es möglich ab Vollendung des 7. Lebensjahrs die Firmung zu empfangen.
In der Praxis wurde das Firmalter in unserer Erzdiözese auf 17 Jahre festgelegt. Man sollte sich an den Pfarrer in seiner Pfarrei wenden. Man kann zu jeder Zeit, auch als Erwachsener, gefirmt werden.
Man muss bereit sein, seinen Glauben durch eine entsprechende Vorbereitung zu vertiefen und den Willen haben, sich kirchlich zu engagieren.
Die Kirche verlangt die Firmung für den Eintritt in einen Orden und für den Empfang der Diakon- oder Priesterweihe.
Um Pate resp. Patin zu werden ist die Firmung Voraussetzung.
Die Kirche empfiehlt die Firmung auch für das Ehesakrament.
Die Firmung ist auch erwünscht für die Ausübung eines kirchlichen Berufes.
Jeder Firmling sollte möglichst einen Paten (oder eine Patin) haben. Der Firmpate (die Firmpatin) muss vom Firmling, seinen Eltern bzw. vom Pfarrer dazu bestimmt sein.
Es ist sinnvoll dass der Taufpate auch der Firmpate ist. Er muss das 16. Lebensjahr vollendet haben, katholisch getauft und gefirmt sein.
Verséinung
Am besten man informiert sich bei einem Pfarrer. In vielen Kirchen gibt es feste Beichttermine (z.B. in der Kathedrale). Man kann auch in Klöstern beichten (z.B. in Clerf) oder einen Priester um ein persönliches Beichtgespräch bitten.
Man muss nicht in einen Beichtstuhl gehen um zu beichten. Viele bevorzugen den Beichtstuhl wegen der Anonymität. Andere beichten lieber im Aussprachezimmer bei einem Priester. Beichten kann man überall.
Nur der Priester allein kann die Lossprechung (Absolution) von den Sünden erteilen.
- Vor der Beichte: Ich denke über mein Leben nach. Ich denke über das nach, was ich falsch gemacht habe. Ich möchte mich ändern.
- Beichte: Ich bekenne dem Priester meine Schuld und bitte um Vergebung. Der Priester hilft mir mein Leben neu zu orientieren. Er spricht mich los von meiner Schuld und legt mir ein Gebet oder ein Werk der Nächstenliebe auf.
- Nach der Beichte: Ich danke Gott. Ich versuche neu den Weg zum Guten zu gehen.
Man kann so oft beichten gehen wie man möchte. Die Kirche lädt die Gläubigen ein, wenigstens einmal im Jahr (z. B. in der österlichen Busszeit) zu beichten.
Der Priester unterliegt dem Beichtgeheimnis. Er ist verpflichtet, über alles was ihm in der Beichte anvertraut wird, zu schweigen. Sogar bei Gericht darf er dieses Schweigen nicht brechen.
Krankesalbung
Sie kann bei jeder ernsthaften Erkrankung empfangen werden. Die Krankensalbung ist kein Sterbesakrament, sie ist eine Stärkung die Christus dem Menschen anbietet.
In den meisten Fällen wird die Krankensalbung erst dann erbeten, wenn der Kranke kurz vor dem Tod steht und oft schon nicht mehr bei Bewußtsein ist. Dies trifft nicht den eigentlichen Sinn des Sakramentes. Hier wäre ein Mentalitätswechsel zu wünschen.
Nur ein Priester kann die Krankensalbung spenden, weil sie in enger Verbindung zum Bußsakrament steht.
Es ist wünschenswert, dass enge Verwandte, Freunde oder Pflegepersonal anwesend sind. Sie können den Kranken durch ihre Gebete unterstützen.
Wenn der Kranke dazu in der Lage ist und es wünscht, kann er vor der Krankensalbung die Beichte ablegen und nachher die Heilige Kommunion (d.h. das eigentliche Sterbesakrament, die Wegzehrung) empfangen.
- Ist der Kranke nicht bettlägerig, so kann er das Sakrament in der Kirche oder an einem anderen passenden Ort empfangen. Es sollte soviel Platz vorhanden sein, dass eventuell Verwandte oder Freunde des Kranken an der Feier teilnehmen können.
- Ist der Kranke bettlägerig wird sie zuhause, im Krankenhaus oder im Altenheim empfangen.
Es gibt verschiedentlich Gemeinschaftsfeiern mit Krankensalbung z.B. in der Oktave während einer Krankenandacht. Es gibt auch Pfarreien, die eine solche Feier anbieten.
In diesem Fall soll die Handauflegung und die mit der sakramentalen Formel verbundene Salbung an jedem einzelnen vollzogen werden. Alle anderen Texte werden nur einmal in der Pluralform gesprochen.
Die Krankensalbung hat ihren Platz in der Situation jeder ernstlichen Erkrankung. Sie kann deshalb mehrmals im Leben, sogar mehrmals innerhalb einer fortschreitenden Krankheit empfangen werden.
Da die Krankensalbung als Stärkung von Schwerkranken gedacht ist, macht es keinen Sinn, sie noch zu spenden, wenn ein Mensch schon tot ist. Das geht aus dem Gebet, das nach der Salbung gesprochen wird, ganz deutlich hervor: „Herr, hilf diesem Kranken in seiner Schwachheit. […] In deinem Erbarmen richte ihn auf und mache ihn gesund an Leib und Seele, damit er sich wiederum seinen Aufgaben widmen kann.“
Wenn der Mensch schon verstorben ist, will die Kirche die Familie in ihrer Trauer begleiten. Gemeinsam mit dem Pfarrer, dem Diakon oder dem Pastoralassistenten bzw. der Pastoralassistentin können sie sich am Bett des Verstorbenen zum gemeinsamen Gebet versammeln. In den meisten Krankenhäusern ist übrigens ein Raum vorgesehen, wo man auch noch am Tage nach dem Tode eine kleine Trauerfeier abhalten kann.
Man wendet sich an den Ortspfarrer oder an das Pastoralteam der Pfarrei. Ist der (die) Kranke in einem Altenheim oder in einem Krankenhaus, so wende man sich an den zuständigen Seelsorger oder an das Pflegepersonal.
Wei
Priester werden können unverheiratete Männer, die ein „Diplôme d’études secondaires classiques“ oder ein „Diplôme d’études secondaires techniques“ besitzen, die bereit sind, sich auf ein eheloses Leben in Gemeinschaft einzulassen und darüber hinaus die nötigen physischen, psychischen und religiösen Voraussetzungen mitbringen. Ein persönliches Gespräch mit dem Seminarpräses ist erfordert. Informationen gibt es auf der Homepage des Priesterseminars.
Die Ausbildung verläuft in drei Etappen:
- Es beginnt mit einem Einführungsjahr (Propädeutikum) im Luxemburger Priesterseminar oder in einem Priesterseminar im Ausland (Trier oder Limelette). Während diesem Jahr lernen die Kandidaten die Kirche kennen und üben sich ein in das philosophische und theologische Denken sowie in das Gebet.
- Danach folgen die philosophischen und theologischen Studien im Ausland (Trier oder Lantershofen). Während dieser Zeit wohnen die Priesteramtskandidaten im dortigen Priesterseminar, in dem auch weitere Ausbildungsveranstaltungen stattfinden.
Eventuell wird ein sogenanntes einjähriges „Aussenstudium“ ausserhalb des Priesterseminars und in einer anderen Universitätsstadt zwischengeschaltet. Darüber hinaus finden während dieser ganzen Zeit in Luxemburg diverse Praktika statt sowie Klausurtagungen zu verschiedenen Themen oder die jährlichen Exerzitien.
- Schliesslich folgt der Pastoralkurs, vor der Priesterweihe, erneut im Luxemburger Priesterseminar. Dieses letzte Ausbildungsjahr ist spezifischer auf die zukünftige pastorale Arbeit des Priesters ausgerichtet und vermittelt die erforderten Kenntnisse und Kompetenzen in den folgenden Bereichen: Kommunikation, Homiletik, Spiritualität, Verwaltung, Liturgie und Religionspädagogik.
Der Pastoralkurs schliesst ab mit einem mehrmonatigen Pfarreipraktikum. Während diesem Jahr - meist im Dezember oder Januar - findet die Diakonenweihe statt, am Ende - im Juni oder Juli - dann die Priesterweihe.
Zunächst kann man sich informieren
- auf der Homepage des Luxemburger Priesterseminars – hier findet man auch die Anschrift des Seminarpräses, der für die Priesterausbildung in Luxemburg zuständig ist;
- oder beim Pfarrer.
In erser Linie werden Priester in der territorialen Seelsorge eingesetzt, d.h. als Pfarrer in einem Pfarrverband. Die Priesterausbildung zielt aber darauf ab, den zukünftigen Priester für zahlreiche Einsatzgebiete vorzubereiten, in Zusammenarbeit mit anderen pastoralen Mitarbeitern: Leben und Verantwortung in der Pfarrei, Katechese und Religionsunterricht, Liturgie, Erwachsenenbildung, Krankenpastoral, Jugendpastoral usw. Weitere Informationen erhält man bei jedem Priester sowie im Luxemburger Priesterseminar.
Bestiednis
Die katholische Kirche in Luxemburg lädt die jungen Paare ein vor der Hochzeit an einem Ehevorbereitungskurs teilzunehmen. Deshalb ist es sinnvoll rechtzeitig mit einem Priester Kontakt aufzunehmen (mindestens 6-10 Monate vor dem gewünschten Datum). Er freut sich darüber, das junge Paar kennen zu lernen und liefert die nötigen Informationen betreffend die zu unternehmenden Schritte.
Einige Wochen vor der kirchlichen Hochzeit begegnen die Brautleute den Priester zum „Brautexamen“ (= Erklärung und Engagement der Brautleute betreffend die rechtlichen Voraussetzungen für die Eheschließung) und um die Hochzeitsfeier vorzubereiten.
Ja. In diesem Fall spricht man von einer bekenntnisverschiedenen Ehe. Um eine solche zu schließen, muss eine Erlaubnis (licentia) eingeholt werden, welche in der Regel nur bei schwerwiegenden Gründen verweigert wird. Voraussetzung für die Erlaubnis ist, dass der katholische Partner sich dafür einsetzt, eventuelle spätere Kinder katholisch zu erziehen. Zur Schließung einer bekenntnisverschiedenen Ehe gibt es verschiedene denkbare Formen:
- Trauung in der katholischen Kirche vor einem katholischen Geistlichen;
- Trauung in der katholischen Kirche vor einem katholischen Geistlichen, unter Mitwirkung eines evangelischen / orthodoxen Geistlichen;
- Eheschließung in einer nichtkatholischen Kirche vor einem nichtkatholischen Geistlichen. Dazu ist für den katholischen Partner eine Dispens seitens des Bischofs nötig.
- Eheschließung in einer nichtkatholischen Kirche vor einem nichtkatholischen Geistlichen, unter Hinzuziehung eines katholischen Geistlichen. Dazu ist für den katholischen Partner eine Dispens seitens des Bischofs nötig.
Welche Form gewählt wird, hängt immer davon ab, wie weit der nichtkatholische Partner bereit ist, mitzugehen. Dies alles soll im Ehevorbereitungsgespräch geklärt werden, ebenso die Frage, ob eher eine Trauungsfeier mit Eucharistiefeier (Messe) oder eine Trauungsfeier ohne Eucharistiefeier (Wortgottesdienst) erwünscht oder angebracht ist.
Ja. In diesem Fall spricht man von einer religionsverschiedenen Ehe. Weil kirchenrechtlich gesehen die Religionsverschiedenheit ein sogenanntes Ehehindernis darstellt, muss zunächst eine Dispens eingeholt werden. Der nichtkatholische Partner wird nicht in die Pflicht genommen. Ist die Dispens erteilt, steht einer katholischen Eheschließung in einer katholischen Kirche nichts mehr im Wege.
Zuständig ist der Pfarrer des Wohnortes des einen oder des anderen der Ehepartner. Sollte die Hochzeit an einem anderen Ort sein, an welchem keiner der beiden Partner wohnt, bedarf es der Erlaubnis (Delegation) eines der beiden Pfarrer der Wohnorte der beiden Ehepartner.
Ja. Im kirchlichen Gesetzbuch steht nirgends, dass die Firmung eine obligatorische Voraussetzung für die kirchliche Trauung sei. Allerdings ist es sinnvoll, dass der Mann und die Frau, die heiraten möchten, gefirmt sind, weil damit die so genannte Initiation (volle Aufnahme in die kirchliche Gemeinschaft) abgeschlossen ist.
Benötigt wird ein aktueller Taufschein (Auszug aus dem Taufregister). Diesen Schein erhält man beim Pfarrer der Pfarrei, in der man getauft worden ist (Anruf genügt). Der Schein darf nicht älter als sechs Monate sein.