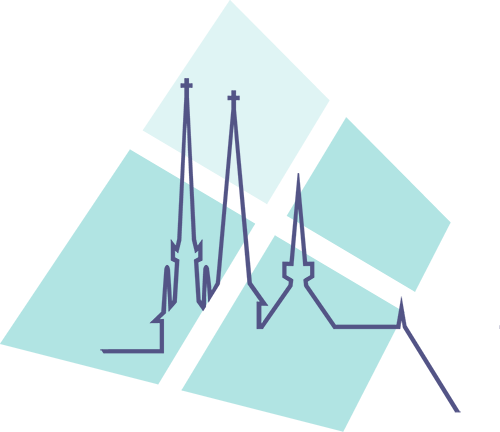Von Eros und Agape - eine Novelle
Kommentar zum 13. Sonntag im Jahreskreis von Jean-Marie Weber (30.06.24)
„Das Wunder ist des Glaubens liebstes Kind“ sagt Faust. Für Lenin war die Oktoberrevolution ein Wunder. Was es mit Glauben, Wunder und Eros auf sich hat, erzählt Markus in einer Novelle (5,21-43), wie zwei Frauen von ihrem Glauben an bestimmte Phantasmen befreit wurden.
Er präsentiert eine „blutflüssige“ Frau, die ihr ganzes Geld ausgegeben hat, um durch ärztliches Wissen von einer Menorrhagie geheilt zu werden. Finanziell und existentiell ist sie am Nullpunkt angelangt. Als Unreine hatte sie keine Chance auf ein erfülltes erotisches und soziales Leben. Seit zwölf Jahren ist sie vermutlich auch in einer Symptomatik gefangen, charakterisiert durch eine Sehnsucht nach einem Mann bei gleichzeitiger Sabotage einer möglichen intimen Beziehung. (E. Drewermann)
Diese Sehnsucht überkommt sie wohl auch in dem Moment, in dem sie dem Mann Jesus begegnet. Wahrscheinlich erwartet sie in ihm jemanden, der anders spricht als die strengen Sittenwächter jener Zeit, die zwischen ihrer Krankheit und der Moral keine Trennlinie ziehen. Und so kommt es, dass sie Jesus berührt; obwohl das Gesetz es verbietet. Irgendwie glaubt sie schon nicht mehr an die Moralvorstellungen, denen sie unterworfen ist. Und in diesem Zweifel wird sie von Jesus bestärkt. Sein Wort ist für sie Grund genug für ihren aufkeimenden Glauben an einen Neuanfang, mit dem Recht auf Liebe und Begehren.
In der Begegnung Jesu mit dem Synagogenvorsteher Jairus wird diese Problematik der Entfremdung weiter vertieft. Seine Tochter droht zu sterben. Zwölf Jahre ist sie alt. Sie steht also kurz vor dem heiratsfähigen Alter, also einer „Hochzeit“ des Eros, des Begehrens und der Liebe. Und doch spricht der Vater immer noch von seinem „Töchterlein“. Man muss kein Anhänger S. Freuds sein, um zu erkennen: Hier stimmt etwas nicht. Es ist wohl problematisch, wenn ein Vater in einem so elaborierten Text von seinem Töchterlein anstatt von unserer Tochter spricht. Wir wissen doch, wie wichtig die Mutter für ein Mädchen ist, um zu lernen, sich mit dem Frausein zu identifizieren.
Die junge Frau kann nicht länger das „kleine Ding“ ihres Vaters bleiben. Dass dieser Trennungsprozess nicht beginnt, lässt sie daran sterben. Gefangen im Genuss der engen Vater-Kind Beziehung ist die Sehnsucht nach Freiheit und Lust, das Vertrauen ins Leben zerbrochen. Vater und Tochter glauben, nicht loslassen zu dürfen. Dem Vater fehlt das Vertrauen ins Leben, wie Jesus bemerkt. Eine ähnliche Problematik zwischen einem Pastor und seiner Tochter wird uns von M. Haneke in seinem Film „Das weiße Band“ erzählt.
Es sind die kleinen Gesten Jesu, die auch in dieser Szene die Problematik deuten. Jesus lädt die Frau des Synagogenvorstehers ein, mit zu ihrer Tochter zu gehen. Damit wird die Fixierung auf die duale Vater-Kind Beziehung aufgebrochen. (Fr. Dolto) Die Mutter wird ermutigt, ihre Rolle als Frau wahrzunehmen. Und der Vater wird aufgefordert, sich seiner Frau gegenüber als ihr Ehemann zu positionieren, so dass die Tochter sich frei von ihm auf die Partnerschaft mit einem jungen Mann freuen kann. Darauf zielen die Worte Jesu: „Tochter, ich sage dir, steh auf!“ Positioniere dich, gehe deinen Weg! Lebe deine Sehnsucht!
Die beiden kranken Frauen dieser Novelle sind Gefangene eines gesellschaftlichen Diskurses und unbewusster Fantasien. Durch seine Liebe zum fragilen Menschen (Agape) hilft Jesus beiden, ihre Entfremdung zu reflektieren und dem Begehren seinen Platz zu geben. Für Platon verbindet uns der Eros mit dem Göttlichen. In der Novelle ist es die Begegnung mit dem „Sohn Gottes“, die zu einem Neuanfang ermutigt. Für S. Zizek ist die Durchquerung des Phantasmas, die Möglichkeit eines Neubeginns, das eigentliche Wunder, welches das Christliche Narrativ auszeichnet.